Geht unsere Sprache den Bach runter? – unter diesem Titel hat Journalistin Nicole Isermann zur Blogparade geladen. Ich hatte mich schon längst entschieden, hier mitzuschreiben - als sie mich mit einer Mail freundlich dazu einlud.
Ehrlicherweise habe ich noch nie für einen Blogpost so oft neu angesetzt. Weil es zu viele Facetten, kreativen Ansätze und Themen gab. Wieder ist es ein langer Text mit vielen Blickwinkeln und Denkanstößen geworden. Daher lade ich Dich ein: Scroll ruhig durch und lies nur, was Dir in den Kram passt. "Textzappen" nenne ich das.
Also jetzt mal ehrlich – versetze Dich doch mal in die Persönlichkeit unserer Muttersprache. Ganz so, als wäre sie ein Mensch. Stell Dir mal vor, wie sich das anfühlen muss, wie die Menschen momentan da draußen so mit Dir umgehen. Da fehlt es an allen Ecken und Ende an Wertschätzung und Unterstützung. Oftmals wirst Du quasi verbal „vergewaltigt“ und aufs absolute Mindestmaß reduziert. In Whats Apps und Chats werden Dir oftmals sogar die Vokale genommen, von Grammatik ist da kaum mehr was zu sehen.
Sprache trudelt … im Fluss der Zeit
Viele deiner liebgewonnen Satzzeichen verschwanden längst im orthographischen Salzsee – wer verwendet heute noch das trennende Semikolon? Der Deppen-Apostroph sagt schon selbst was über seinen Wert - und spätestens beim Halbgeviertstrich ist vielen völlig unklar, dass es sich um eines deiner Interpunktionszeichen handelt. Vom „Interrobang“ (einer Kombi aus Frage- und Ausrufezeichen) habe auch ich heute bei meiner Recherche selbst erstmalig gelesen.
Wir behandeln unsere Sprache wie einen zuverlässigen Mitarbeiter in unserer Firma, der permanent anwesend ist und stets hart am Limit arbeitet. Weil er nicht meckert, werfen ihm noch mehr Aufgaben hin. Doch auch unsere Sprache hat offenbar mit einem Fachkräftemangel zu tun. Denn immer weniger sind wirklich sprach-fit und steuern der aktuellen Entwicklung angemessen gegen. Denn Sprachveränderung wird gefühlt zur reißenden Flut …
Sprache soll aktuell beispielweise …
… leicht erlernbar sein
… integrierend wirken
… inklusiv sein
… gendergerecht formuliert sein
… einfach verständlich bleiben
… politisch korrekt sein
… sich der aktuellen Situation anpassen
… keinesfalls diskriminieren
… allen Generationen sprachlich gerecht werden – und noch so viel mehr.
Jeden Tag kommen neue Anforderungen auf die Sprache zu – und irgendwie sind genau diese Anforderungen oft sogar widersprüchlich. Die einen sehen Gendern als unverzichtbar an, die anderen lehnen es aufs Heftigste ab. Beide haben durchaus gute Gründe dafür.
Zudem wird Sprache aktuell heftig mit einer Über-Befindlichkeit in vielen Bereichen konfrontiert. Ob die „Einbürgerung“ von Vokabeln aus fremdländischen Sprachwelten (ähm, wir hatten immer schon viele Worte, die an andere Sprachen „angelehnt“ waren – und auch andere Sprachen haben deutsche Worte „vereinnahmt“), ob fragwürdige Rechtschreibreform (da hätte man sinnigerweise doch im Computerzeitalter auch mal gleich das „ß“ und die Umlaute „ä“, „ö“ und „ü“ abschaffen können) oder Marketingsprech (ach, das Wort Handy gibt es übrigens nur im Deutschen, das ist keineswegs englisch (mobile) oder amerikanisch (cellphone)).
Und dann noch das Thema mit der kulturellen Aneignung, bezüglich derer genügend Diskussionen vollkommen überzogen und gerne mal ahnungslos unsachlich geführt werden. Unsere Sprache … gerät in falsche Fahrwasser und wird „gekapert“.
Sprache braucht dringend einen Rettungsring
Ich kann vollkommen verstehen, dass unsere Sprache derzeit in einer Art Sinnkrise steckt und heftig mit ihren Wort-Armen rudert. Denn wir alle haben sie zu wenig wertgeschätzt und behandeln sie schlecht. Indem wir uns zu wenig Gedanken machen, was für eine phänomenale Bedeutung Sprache für unser Miteinander hat. Es ist an der Zeit, dass wir ihr einen Rettungsring der Wertschätzung zuwerfen. Dass wir sie wieder pflegen und ihr das Gefühl geben, dass sie uns einen tollen Dienst erweist.
Stattdessen wechseln wir immer mehr in die „einfache Sprache“, weil Menschen mit dem Lesen langer Texte aufgrund mieser Konzentrationsspanne und fehlender Übung Probleme haben. Weil sich Menschen Gefühl immer weniger um ihre Sprache bemühen.
Was bringt uns Sprache eigentlich?
Schauen wir mal kurz zurück ins Neanderthal. Da gab es noch keine Sprache, nur gutturale Laute. (Anmerkung: Und Höhlenzeichnungen, die uns noch heute – nur inzwischen am Flipchart oder digital - Verständniszusammenhänge erläutern). Dass Menschen heute miteinander reden können, hat viele Vorteile. Denn sprachlich lassen sich – zumindest in der Theorie – Konflikte vermeiden oder zumindest reduzieren. Wenn alle Beteiligten redewillig und zum zielführenden Umgang mit Sprache bereit und in der Lage sind. Wie heißt es so schön: Sprechenden Menschen kann geholfen werden. Sie ermöglicht Austausch, bringt uns Klarheit und steigert im besten Fall das gegenseitige Verstehen.
Wie kommen wir zur Sprache?
Wir haben in der Kindheit von unseren Eltern, unserem Umfeld und in der Schule die (Mutter-)Sprache gelernt. Das ist die "Sprachpersönlichkeit", mit der wir heute sehr vertraut sind. Weil wir sie so schon ein Leben lang kennen und benutzen.
Deswegen pflegen auch Generationen jeweils ihre eigene Sprache. Meine Großeltern gingen ins Lichtspieltheater, wir gehen ins Kino, die Kids netflixen. Unsere Großeltern gingen tanzen, unsere Eltern auf eine Party, wir auf eine Fete, unsere Jungs gingen abhotten. Bedeutet: Sprache "fließt" mit den verändernden Rahmenbedingungen mit.
Sprache – das ist mehr als nur Wort und Schrift
Wir haben gelernt, dass Sprache vieles leichter macht. Wenn wir unser Gegenüber - inklusive Haltung und Körpersprache – sehen können, wird das Verstehen einfacher. Selbst am Telefon hören wir Tonfall, Lautstärke, Sprechtempo, Sprachmodulation und Stimmlage. Das hilft uns, das Gesamtbild für Stimmung und Verstehen zu vervollkommnen. Je mehr wir an Information über unsere Kommunikationskanäle Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen erhalten, desto einfacher wird das Miteinander. Synchrone Kommunikation – als Gespräch oder Telefonat - hat massive Vorteile gegenüber asynchroner Kommunikation - weil sich Missverständnis weniger ergeben - und leichter ausmerzen lassen.
Kommunizieren wir schriftlich, wird es schon weit mühsamer. Denn wichtige Kommunikationskanäle fehlen. Wenn dann noch – wie eben beispielsweise in Chats, SMS oder WhatsApp - der Faktor Zeit hinzukommt, wird’s stressig. Weil eine zunehmende Ultrakurzform – mit Verzicht auf Begrüßungsformeln, vermeidbare Worte, Groß- und Kleinschreibung sowie eben … Vokale – das Sprachverständnis austrocknen lässt. Und auch den gegenseitigen Respekt auf ein Minimum reduziert. Das alles sorgt für eine zunehmende Zahl an Missverständnissen und Missstimmung (ja, 3 x "s" ist hier korrekt, es folgt ein Konsonant ;-)).
Warum wir Sprachpräzision brauchen
Es gibt mehrere Dinge, die mich im Alltag schlicht zum Wahnsinn treiben. Als Tochter eines Wirtschaftsjournalisten wurde mir von klein auf der respektvolle und virtuose Umgang mit Sprache vorgelebt. Und ja, auch antrainiert. Ich war – und bin – eine Leseratte. Lesen bildet eben keineswegs nur inhaltlich, sondern eben auch in Sachen Wortschatz, Satzbau und Interpunktion. Wir Sprachakrobaten haben eine sprachliche Vielfalt, die es uns ermöglicht, uns absolut präzise – und eben auch in korrektem Deutsch - auszudrücken. So schaffen wir Lesewelten, in denen der Lesefluss möglichst wenig behindert wird. Damit es dem Lesenden leicht gemacht wird, zu verstehen und zu folgen.
Doch auch, weil wir nur so Dinge wirklich genau darstellen können - und Fehlinterpretationen vermeiden. So richtig voll auf die Zwölf ... das erhöht auch die Freude beim Lesen oder in der Diskussion. Sprachwitz kann so unglaublich viel Spaß machen!
Meine persönlichen Sprach-Untiefen
Es gibt ein paar typische Fehler, die ich fast täglich irgendwo höre oder lese. Das kann mich manchmal zur Verzweiflung treiben, weil es mir in Augen und Ohren weh tut. Vor allem dann, wenn die Sprechenden oder Schreibenden es gar nicht besser lernen WOLLEN. Echte Sprachignoranten also. Davon gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Denn Sprache kann eben auch manchmal mühsam sein. Hier meine Top 7:
Falsch: Einzigste
Korrekt: Einzige
Es gibt keinen Komparativ oder gar Superlativ, denn der/ die Einzige ist ja schon aus der Wortbedeutung der/ die ultimativ Einzige. „Allein“ oder „nur“ kannst Du übrigens auch nicht steigern.
Falsch: Helf´
Korrekt: Hilf´
Helfen ist ein sogenanntes "starkes" Verb. Das bedeutet, dass es seine Stammformen mit Vokalwechsel bildet: Erste Stammform hilft. Gilt also auch für fallen, fahren, lassen, laufen, sehen, schlagen, waschen, halten, fangen …)
Falsch: Herzlich Willkommen
Korrekt: Herzlich willkommen
Willkommen ist hier ein Adjektiv. Du kannst es substantiviert auch groß schreiben, doch dann würde es „ein herzliches Willkommen“ heißen.
Falsch: unperfekt, inperfekt
Korrekt: imperfekt
„Unperfekt“ als Antonym von „perfekt? Es liegt nahe, an perfekt einfach ein „un-“ dranzuhängen. Doch unperfekt gibt es als offizielles Wort (noch) nicht.
Zum Angriff: Meine Sprachpiraten
Neben grammatikalischem oder orthograhpischem Fehltritt gibt es allerdings auch noch meine persönlichen Sprachpiraten, die immer wieder meine Ohren oder Augen angreifen. Allen voran die Unsitte der Verlaufsform …
Unschön: Ich bin am Bügeln.
Erfreulicher: Ich bügle.
Die so genannte „rheinische Verlaufsform“ greift derzeit wie ein Virus um sich. Das ist nicht falsch, aber unschön, wenn Verben auf diese Weise substantiviert werden.
Es scheint zunächst einfacher, schlicht „am“ + Verb zu verwenden. Bei Sprachlernenden ist das nachvollziehbar und – auch für mich – tolerabel. In Fremdsprachen starten wir stets in der Gegenwartsform und werden erstmal verstanden. Doch bei Muttersprachlern finde ich das … nunja … schwierig. Zumal der Gewinn bei der Denkarbeit, welches denn wohl die richtige Form ist, durch die Mehrarbeit beim Schreiben wieder aufgebraucht wird. Und das Thema Groß- und Kleinschreibung kommt hier auch noch erschwerend hinzu. Es ist also im Grunde kein wirklicher Effizienzvorteil.
Als Autorin käme mir diese Verlaufsform keineswegs in den Sinn. Viel zu viel Aufwand. Zudem brauche ich ja für andere Zeitformen eh wieder die korrekte Endung. Dann kann ich sie auch gleich für die Gegenwart verwenden, oder?
Seit wann seid Ihr Passagiere auf der MS Deutsch?
Seit + Seid
Kennste, ne? – diese typische Verwechslung der beiden Schreibweisen. Dabei ist es eigentlich kein Hexenwerk, hier ans rettende Ufer zu gelangen:
Seit: Sobald es um eine Zeitangabe geht – also „seit wann…“?
Seid: 2. Person Plural des Verbes „sein“ –
Als + Wie
Als wird bei Ungleichheit verwendet:
Ich bin größer, als Du.
Wie ist ´korrekt, wenn es um Gleichheit geht:
Ich spreche genauso gut Deutsch, wie Du.
Sprach-Schwimmflügel – in eigener Sache
Du denkst, ich hielte mich in Sachen deutscher Sprache für perfekt? Du irrst. Ich bin seit der Rechtschreibreform sogar rechtschaffen verunsichert - weil mir das ja nicht mehr von einem Lehrer vermittelt wurde. Dieses blöde Doppel-S versus Eszett/ scharfes „S“ (ja, das „ß“ schreibt sich wirklich so – ich musste es gerade auch erst googeln!) macht mich irre. Dabei ist es doch im Grunde leicht zu verstehen:
„Ich trinke Alkohol in Maßen (= bayerischer Bierseidel)“ bedeutet etwas anderes, als „Ich trinke Alkohol im Massen“. Dennoch habe ich damit so meine Probleme.
Dasselbe gilt für Groß- und Kleinschreibung, wenn ich – wie in letzter Zeit häufiger – auch Texte in Englisch verfasse. Normal kann ich da meiner Intuition vertrauen, doch nach dem Schreiben englischer Mails und Texte bemerke ich, dass ich öfter stolpere und nachdenken muss.
Ich gestehe … ich bin eine absolute Grammatik-Niete. Habe das alles zwar mal offiziell gelernt, doch schnell wieder vergessen. Weil ich es durchs Lesen einfach „konnte“.
Ich kann das keineswegs sauber erklären, doch ich weiß zu 99 % aus meiner Erfahrung, wie es richtig sein müsste – also bis zu dieser unsäglichen Rechtschreibreform. Deswegen war dieser Blogpost für mich eine Art Selbstlerneinheit. Durch die Recherche habe ich mir selbst mal wieder die tatsächlichen Erklärungen zu meiner Intuition geholt. Ich habe mir also quasi die Schwimmflügel angezogen und Trockenübungen gemacht.
Alle meine Entchen schwimmen auf dem See …
Unsere Sprache ist wunderschön. Das haben Dichter und Denker bewiesen. Liedtexter, Blogger, Autoren und alle, die wundervolle Liebesbriefe schreiben. Ich bin selber eine Frau – doch dieser Genderwahnsinn dreht mir die Fußnägel nach oben.
Versteh´ mich jetzt richtig: Ich finde diese Genderidee in der Sache durchaus richtig – doch die Art der „Regatta“, die wir da gerade segeln, geht für mich in die falsche Richtung. Wenn wir gendern, was wir bitte tun sollten, dann doch bitte so, dass unsere Sprache dabei keinesfalls bewusst verletzt und verhunzt wird.
Wo es geht, können wir beispielsweise von Teilnehmenden oder Zuhörenden sprechen oder schreiben. Wir dürfen abwechselnd die maskuline und feminine Version der Worte verwenden. Es ist möglich, das generische Maskulinum zu umgehen, indem wir facettenreicher formulieren … wo ein Wille ist, da ist auch ein Ufer.
Das U-Boot der Genderpolizei kreuzt
Vor einigen Jahren tauchte jedoch das U-Boot der Genderpolizei in unserem Sprach-Bach auf. Von Beginn an (meine Wahrnehmung – die ja bekanntermaßen subjektiv ist!) ziemlich auf Kriegkurs: Gendersternchen, Doppelpunkte, Binnen-I und andere typographische Wortvergewaltigungen lagerten im Waffenarsenal. Dieser – an sich gut gemeinte - Angriff zur Verteidigung der Femininität sorgt für mächtig Unruhe in unserem Sprachfluss.
Die wiederum ist für Menschen, die unsere Sprache lernen "dürfen", ein schlichter Horror – weil es nicht einmal die Deutschen beherrschen und sauber vermitteln können. Weil es zusätzliche Bemühungen erfordert, die mit etwas gutem Willen vermeidbar wären. Es bremst zudem viele (vor allem ältere) Vorlesegeräte für Sehbehinderte und Senioren böse aus - Inklusionshemmung also. Es ist für Kinder beim Spracherwerb und Schreibenlernen einfach nur … gemein.
Vor allem jedoch schafft es Fronten zwischen kompromissbereitschaftsbefreiten Erzwingenwollern (kicher … Wortungetüm!) – also der selbsternannten Genderpolizei - und den inzwischen ebenfalls ziemlich bockigen Verweigerern.
Ich gebe zu, ich gehörte aufgrund der Vehemenz der eingesetzten Mittel auch erstmal dazu. Inzwischen bin ich auf Kurs. Gendern ja, aber sprach- und menschenverträglich. Auf meine eigene Art und Weise. Ich vermeide nach Möglichkeit alle komplizierten Arten des Genderns - und in meinen Publikationen auch alles, was Texte unnötig länger macht.
Kurz: Ich wechsele die maskuline und die feminine Form ab – im Rahmen meiner Möglichkeiten. Verwende geschlechtsneutrale Begriffe und ... lerne täglich hinzu. Immer mit der Mission: #IMPERFEKTIONrockt. Denn sonst wäre ich nur noch damit beschäftigt, hier alles nochmal und nochmal zu überprüfen.
Frieden schaffen – ohne Sprach-Strudel
Wir haben aktuell – auch in Deutschland - schon viel zu viele Fronten, an denen wir uns als Gesellschaft aufreiben. Ob Religion, Klima, Geflüchtete, Energie, Preise, Kriege, Politik, Sport und vieles mehr. Wir brauchen definitiv keine weitere Front mit neuer Bedrohungslage.
Mein Appell: Lasst uns gemeinsam einen friedlichen Weg finden, wie wir alle (darunter auch die eher umlern-resistenteren Älteren, deren Maskulinität an dieser Stelle offenbar gewaltig leidet) mit einem positiven Gefühl gendern können. Das alles setzt allerdings eine auf allen Seiten vorhandene Kompromissbereitschaft (verdammt, das hätte ich jetzt fast mit Eszett geschrieben…) voraus. Bei der beide Seiten aufeinander zugehen, statt sich verbale Kriegserklärungen zuzuwerfen.
Mein Sprach-Fazit
Die deutsche Sprache war und ist ständiger Veränderung unterworfen. Das ist auch erstmal gut so. Denn mit einer sich verändernden Welt darf Sprache mitfließen. Begriffe wie „Chat“ oder „googeln“ aus dem Englischen, „Matratze“ und „makaber“ aus dem Arabischen, „Limette“ und „Kompliment“ aus dem Spanischen oder auch „cringe“ und „mütend“ aus der Jugendsprache 2021 gehören längst zu unserem Alltag. Wir sprechen heute eine weniger schwülstige Sprache, wir schaffen neue Wortkreationen für Dinge, die es früher einfach noch nicht gab.
Dennoch wünsche ich mir, dass wieder mehr Menschen sich die Mühe machen, unsere Sprache als Kulturgut und vor allem auch als Kommunikationsmittel zur Konfliktvermeidung zu erhalten. Das bedeutet, sie – nach Möglichkeit – angemessen zu verwenden. Ich persönlich empfinde ein „ey, Alter, ey …“ dann doch eher als primitive Sprachverhunzung. Wer mich mit „Digga“ anspricht, bekäme keine Antwort. Dennoch verstehe ich auch die Jugendlichen in ihren Abgrenzungsbedürfnissen.Ein letztes Wort ist übrigens mein persönlicher Endgegner: Boomer – als Schimpfwort. Damit wird eine ganze Generation (die der Babyboomer mit den Geburtsjahrgängen 1946 – 1964) respektlos vor den Kopf geschlagen. Weil die Jüngeren es meist sehr verächtlich und abwertend – verbunden mit oft wirklich unangemessenen Vorwürfen - benutzen. Dabei sollte ihnen bewusst sein, dass sie ohne diese Generation heute vermutlich kein Wort sprechen könnten, weil sie im Fluss der Weltgeschichte nie aufgetaucht wären.
Die deutsche Sprache braucht keinen Rettungsring. Denn die Menschen halten sie auf ihre Weise ohnehin über Wasser. Es wird immer Befürworter und Gegner geben. Doch wir sind gefragt, mit dem, was zu unserer Zeit "Sprachgebrauch" ist, verantwortlich umzugehen. Das bedeutet, dass wir, wenn wir unsicher werden, auch mal ein wenig aktiv "paddeln", indem wir unser Schulwissen einfach mal bewusst aktualisieren.




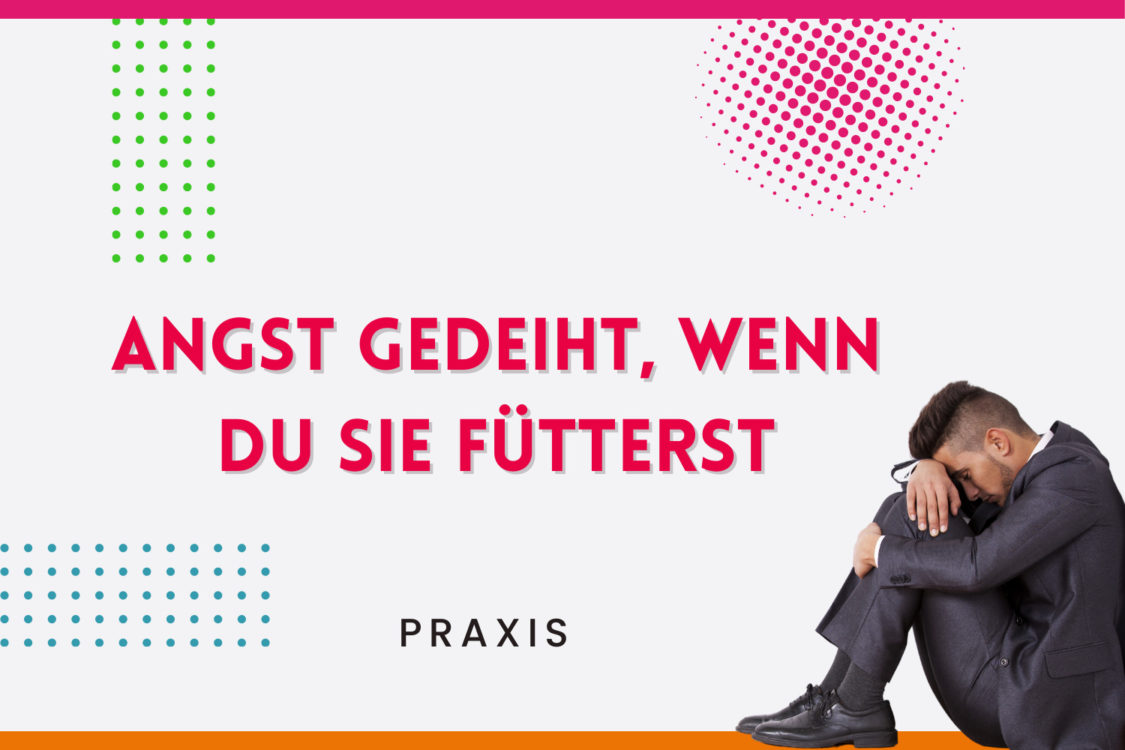
Sehr schöner Text und ich habe sogar etwas gelernt. Gibt es das Wort “ unperfekt “ wirklich nicht? Ich sage es schon seit gefühlten 47 Jahren 🙂 also muss es doch existieren, während ich imperfekt noch nie von jemandem gehört habe. Als und Wie verwechsle ich ständig… Was mich eher nervt sind Füllwörter wie „genau“, das sagen mittlerweile 99% meiner Mitmenschen an Stellen im Satz, wo es wirklich nicht hingehört… und mir rollen sich die Fußnägel hoch, wenn ich Verballhornungen wie Freund:Innen|schaften lese. Das ist kein Witz…
Von ganzem Herzen stimme ich Dir gerne zu, was diese „gegenderten“ Schreibweisen angeht – das ist einfach nur lesehemmend und … nervt. Ich habe nix gegen das Gendern, doch es geht eben auch geschmeidiger, indem wir die maskuline und feminine Schreibweise schlichtweg abwechselnd verwenden. Dann stört es keineswegs beim Lesen, der Autor muss nicht mehr Text schreiben (samt tipp-unfreudiger Sonderzeichen) und wir verbrauchen nicht unnütz mehr Ressourcen für deutlich verlängerte Texte. Bin also voll bei Dir 😉
Was das Thema #Imperfektion angeht: Im Duden steht „unperfekt“ in keiner Form. Doch ich bin sicher, dass sich „unperfekt“ schon zeitnah in den Sprachgebrauch einschleicht – und bald auch als „korrekt“ akzeptiert werden wird. Einfach, WEIL es schon viele so benutzen. Die sich schlicht in keiner Weise daran stören, dass es eben derzeit noch als falsch gilt.
Das mit als (Vergleich mit großer Differenz – ich bin kleiner ALS Du) und wie (Vergleich ohne nennenswerte Differenz – ich bin so groß WIE Du) ist doch kein Hexenwerk. Das kriegst Du sicher hin, wenn es Dir wichtig ist 😉
Füllwörter sind nix anderes als „ausgesprochene“ Pausen, weil wir Pausen im Redefluss nur schwer aushalten können. Auch deshalb, weil in diesen die anderen Gesprächsteilnehmenden gerne das Wort sofort an sich reißen 😉
Wir hören ja nicht mehr zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Also warten wir nur auf eine Chance, „reinzugrätschen“. Doch unser Gehirn braucht auch Pausen, um Gesagten zu verarbeiten. Daher sind „unausgesprochene“ Pausen immer ein Geschenk für die Zuhörenden.